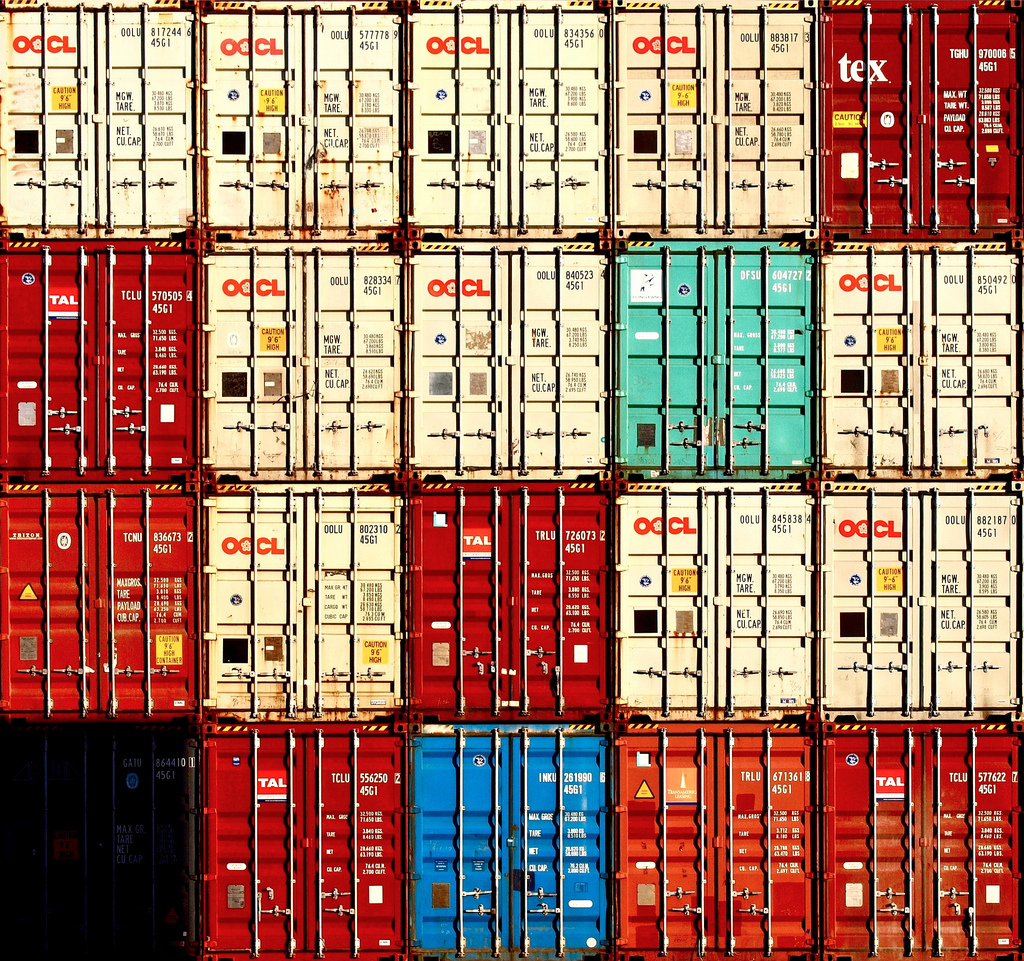Um Funktionsstörungen des Bewegungssystems definieren zu können, ist eine gezielte und systematisch strukturierte Arbeitsweise notwendig. Neben der Beachtung und Beurteilung der Gelenkmechanik ist das systematische Vorgehen in der Untersuchung und Behandlung von Patienten ein weiteres wichtiges Merkmal der Manuellen Therapie (Schomacher 2011). Nachdem im letzten Blog das systematisch an Leitfragen orientierte Vorgehen vorgestellt wurde, erfahrt Ihr heute mehr über das Mustererkennen.
Mustererkennen
Experten denken anders als Novizen, sie können auf der Basis weniger Informationen schnell und scheinbar mühelos Diagnosen stellen (Klemme und Siegmann 2006). Das Mustererkennen (Pattern recognition) ist ein induktives (heuristisches) Vorgehen, dass eine „Diagnose auf den ersten Blick“ erlaubt (Cutler 1998).
Im Laufe der beruflichen Entwicklung eines Therapeuten werden Muster angelegt, die in einer konkreten Situation wiedererkannt und abrufbar sind. Dabei erfolgt ein Abgleich von Merkmalskonstellationen von vorher gespeicherten Informationen oder Erfahrungen mit denen, die der aktuelle Patient zeigt. Bowen (2006) beschreibt die Pattern recognition als ganzheitliche Erkennung von Ähnlichkeiten zwischen einem Patienten und einem früheren Patienten, also als einen Abgleich zwischen dem aktuellen Fall und zuvor erlebten Fällen (Bowen 2006). Mattingly und Fleming (1994a) beschreiben den Prozess des Mustererkennens in vier aufeianderfolgenden Schritten:
- Wahrnehmung eines Phänomens
- Erkennen bestimmter Charakteristika auf der Basis bestimmter Stichworte (Cues)
- Beziehungen zwischen den einzelnen Stichworten herstellen
- Abgleich der gegenwärtigen Anordnung mit einer früher gelernten Kategorie oder einer bestimmten Vorlage
Stichworte, die in einer therapeutischen Situation erkannt werden, können dabei nicht nur einem, sondern mehreren Mustern zugeordnet werden. Diese müssen mental solange in verschieden mögliche Anordnungen gebracht und in Muster eingeordnet werden, bis ein Muster stimmig ist (Klemme und Siegmannn 2006). Solange neu aufgenommene Informationen zu den aufgerufenen Mustern passen, muss kein aktives Clinical Reasoning betrieben werden (Boshuizen und Schmidt 2000). Wie auch bei dem hypothetisch deduktiven Vorgehen stehen sich hier anstatt konkurrierender Hypothesen, konkurrierende Muster einander gegenüber die miteinander abgeglichen werden müssen. Das Muster welches dann die meisten Überschneidungen mit dem aktuellen Fall aufweist, wird favorisiert (Klemme und Siegmann 2006).
Die Struktur in der das Wissen abgelegt ist, wird von den Autoren in der Literatur unterschiedlich benannt. Hayes und Adams (2000) benutzen Begriffe wie Muster, Boshuizen und Schmidt (2000) sprechen von „Ilness scripts“ und „Concepts“ (Boshuizen und Schmidt 2000, Hayes und Adams 2000). Darunter verstehen sie Wissensstrukturen, in denen Fakten, die der Therapeut in der Vergangenheit bei Untersuchungen und Behandlungen aufgenommen hat, wie in Kategorien (Listen) gruppiert und gespeichert sind (Boshuizen und Schmidt 2000). Mögliche Kategorien für ein Muster zur Wissensstrukturierung im Bereich der musculoskelettalen Physiotherapie (Manuellen Therapie):
Aktivitäts- & Partizipationseinschränkungen
Lokalisation & Charakteristik der Symptome
Verhalten der Symptome (Provokation, Linderung, 24-h-Verhalten)
Geschichte
Pathobiologischer Mechanismus
Bewegungsrichtung/Schmerzauslösender Bereich/Funktion/Struktur
Beitragende Faktoren
Differentialdiagnostik
Vorsichtsmaßnahmen/ Kontraindikationen
Physische Untersuchung (Inspektion, Funktionsuntersuchung, Palpation etc.)
Management
Vorteile:
- Schnelles und effizientes Vorgehen vor allem bei Experten, dabei ist aber eine große und gut organisierte Wissensbasis notwendig (Schomacher 2014)
Nachteile:
- Zu schnelle Einordnung eines Problems in eine falsche Kategorie
- Übersehen von klinisch wichtigen Befunden, durch zu schnelles festhalten an einem Muster
Literatur
Boshuizen HPA, Schmidt HG. The development of clinical reasoning expertise. In Higgs J, Jones M eds. Clinical Reasoning in the health professions. 2nd ed. Oxford: Butterworth Heinemann 2000: 15-22.
Bowen JL. Educational strategies to promote clinical diagnostic reasoning. In: The new England journal of medicine. 2006; 355:2217-2225.
Cutler P. Problem Solving in Clinical Medicine, From Data to Diagnosis. Philadelphia: Lippincott Wiliams & Witkins 1998.
Hayes B, Adams R. Parallels between clinical reasoning and categorization. In Higgs J, Jones M eds. Clinical Reasoning in the health professions. 2nd ed. Oxford: Butterworth Heinemann 2000: 45-53.
Klemme B, Siegmann G. Clinical Reasoning – Therapeutische Denkprozesse Lernen. Stuttgart-New York: Georg Thieme Verlag 2006.
Mattingly C. Occupational Therapy as a two body practice. The lived body. In: MattinglyC, Fleming MH. Eds. Clinical Reasoning. Forms of Inquiry in a therapeutic practice. Philadelphia: F.A. Davies 1994.
Schomacher J. Clinical Reasoning und Vorgehensweisen in der OMT. Masterstudiengang Musculoskelettale Physiotherapie der Donau-Universität 2014, Krems.
Schomacher J. Manuelle Therapie: Bewegen und Spüren Lernen. 5. Aufl. Stuttgart – New York: Georg Thieme Verlag 2011.